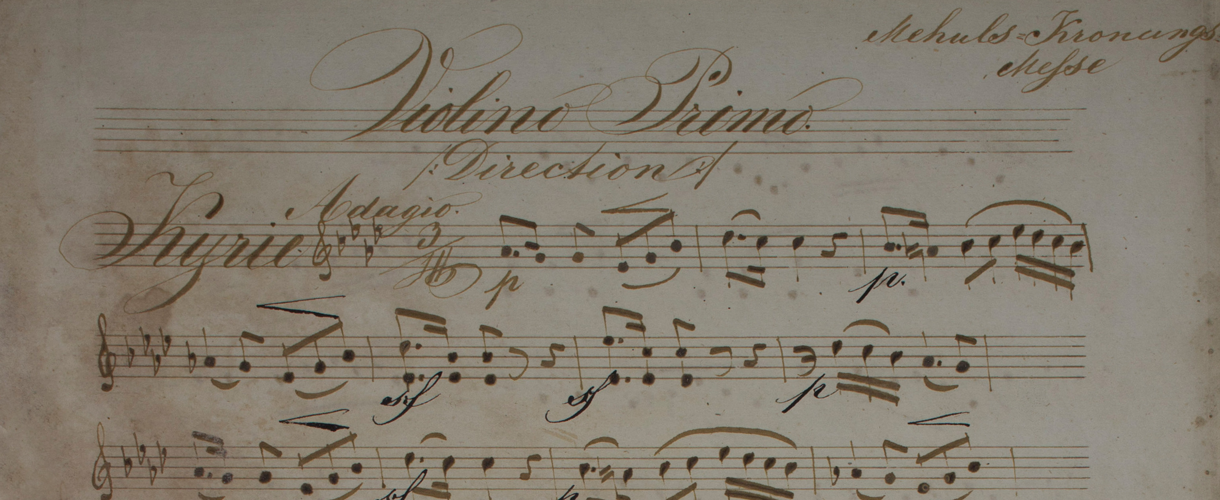Der Blutdruck steigt, das Herz klopft schneller, wir schwitzen: Wenn wir gestresst sind, werden die Hormone Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet. Stress ist eine Art Notfallreaktion des Körpers, wodurch dieser alarmiert wird und kurzfristig mehr Energie verfügbar ist. Stress hat jedoch nicht nur körperliche Auswirkungen, sondern beeinflusst auch das Denken und Fühlen. „Das ist den meisten gar nicht bewusst“, erzählt die Psychologin Livia Tomova, die sich in ihrer Forschung auf kognitive Neurowissenschaft spezialisiert hat.
Tomova, die kürzlich ein Stipendium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und der Max Kade Foundation erhalten hat, befasst sich schon seit Längerem mit den Auswirkungen von Stress auf soziale Kognitionen und Emotionen. In ihrer Forschung konzentriert sie sich auf akuten Stress, der im Unterschied zum chronischen Stress physiologisch positiv einzuordnen ist: „Stress hat nicht nur negative Effekte, er kann körperliche und geistige Prozesse auch verbessern: wir sind aufmerksamer oder handeln zum Teil auch sozialer“, sagt sie. Bisherige Ergebnisse haben etwa gezeigt, dass unter Stress Gefühle anderer verstärkt übernommen werden, aber gleichzeitig die Fähigkeit, sich in andere Personen hineinzuversetzen, vermindert sein kann.
Verhaltensforschung im Magnetresonanztomografen
In einem Pilotprojekt an der Universität Wien erforschte Tomova Veränderungen auf neuronaler Ebene und im sozialen Verhalten von Proband/innen, die unter Stress standen und einerseits selbst belohnt wurden, andererseits beobachteten, wie andere Personen belohnt wurden. Die Proband/innen lagen während des gesamten Experiments in einem Magnetresonanztomografen, um die Gehirnaktivität zu messen. Zu Beginn mussten sie Rechnungen unter Zeit- und Leistungsdruck lösen. Über Speichelproben vor, während und nach den Rechnungstests wurde der Cortisolspiegel und somit der Stresspegel gemessen. Anschließend spielten sie eine Art Lotterie mit Glücksrad entweder für sich oder für eine andere Person.
Stress hat nicht nur negative Effekte, er kann körperliche und geistige Prozesse auch verbessern.
In dem Projekt ging es um die sogenannte „sekundäre Belohnung“ durch Geld – sekundär, weil die belohnende Eigenschaft von Geld erst erlernt werden muss. Eine der Forschungsfragen, die sich Tomova stellte, war, ob sich gestresste Menschen bei Spielerfolg in die Glücksgefühle anderer besser hineinversetzen können als in der Kontrollbedingung ohne Stress.
Großzügigkeit als Maß für prosoziales Verhalten
Diese Untersuchungen wird Tomova dank des ÖAW-Stipendiums nun ab September am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) fortsetzen. Einerseits wird sie die an der Universität Wien gesammelten Daten in einem neuen Experiment verifizieren, andererseits wird sie ihre Forschung mit weiteren Experimenten fortführen. Vor über einem Jahr war sie bereits im Rahmen eines Marietta Blau Stipendiums für sechs Monate am MIT. „Dort gab es so gut wie täglich spannende Vorträge, die inspirierend waren – außerdem hat das Institut zwei MRT-Scanner im gleichen Gebäude“, erzählt die Forscherin.
Nun wird es auch darum gehen, ob stressbedingte neuronale Veränderungen tatsächlich langfristig Konsequenzen auf das soziale Handeln haben. Teilen etwa Proband/innen nach dem Experiment ihr Geld mit anderen? Um dieser Frage nachzugehen, wird Tomova mit dem sogenannten „Dictator Game“ arbeiten, das aus der Verhaltensökonomie stammt: Die Versuchsperson erhält nach dem Experiment eine gewisse Geldsumme. Ihr wird gesagt, dass sie so viel wie sie möchte einer anderen, anonymen Person geben kann – es gibt allerdings keinen Zwang, das Geld überhaupt zu teilen. Die zweite Person erfährt nichts von dieser Entscheidung. Weil die erste Person damit frei von Konsequenzen entscheidet, gilt die Summe des hergegebenen Geldes als Maß für ihr prosoziales Verhalten.
Essen als Belohnung
Neben der sekundären Belohnung durch Geld plant Tomova einen weiteren Test, um die Wirkung von „primärer Belohnung“ auf gestresste Versuchspersonen zu analysieren, also jener Dinge, die direkt das Belohnungssystem aktivieren, wie etwa Essen. Die Proband/innen müssen daher vor dem Versuch eine Liste mit verschiedenen Speisen, wie etwa Äpfel, Chips oder Schokoriegel, nach persönlichen Vorlieben zuordnen.
Unter Stress sind wir aufmerksamer oder handeln zum Teil auch sozialer.
Während ein MRT-Scan läuft werden Bilder von jeweils zwei Speisen aus dieser Liste nebeneinander präsentiert – und zwar eine, die im Vorfeld hoch, und eine, die niedriger bewertet wurde. Die Versuchspersonen müssen aussuchen, welche der beiden sie lieber am Ende des Experiments bekommen würden. Sie entscheiden nicht nur für sich selbst, sondern wie bereits beim Experiment mit dem Glücksrad auch für andere Proband/innen, von denen sie wissen, dass sie die Speisen sehr ähnlich wie sie selbst bewertet haben. Auch hier werden dadurch neuronale Veränderungen während der Belohnungserwartung beobachtet.
Durch diese Experimente erhofft sich Tomova noch detailliertere Informationen über ein verändertes Sozialverhalten unter Einfluss von Stress zu erhalten. Konkret erwartet die Forscherin als Ergebnis, dass gestresste Personen ein höheres prosoziales Verhalten an den Tag legen, sich also die neuronalen Muster während der Belohnungserwartung, wenn es einen selbst und andere betrifft, angleichen. „Wenn wir zeigen können, dass sich Stress direkt auf neuronale Muster von Belohnungsverarbeitung für sich und andere Personen auswirkt, könnte das erklären, warum Personen unter Stress zum Teil sozialer Handeln“, sagt die junge Forscherin.