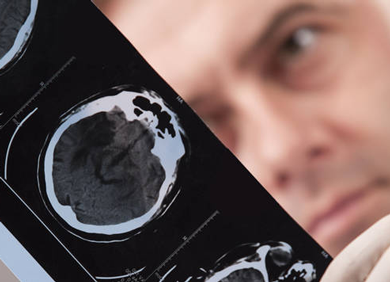Damit aus bloßen Lichtsignalen Bilder werden, die über Krankheiten Auskunft geben können, braucht es die Mathematik. „Wenn man wie bei einer optischen Kohärenztomographie oder einer photoakustischen Tomografie Laser in ein Gewebe schickt, bekommt man zwar unterschiedliche Signale – diese allein lassen aber in vielen Fällen noch keine Rückschlüsse auf den Zustand des Gewebes zu“, erklärt der Mathematiker Otmar Scherzer vom Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW).
Seit einigen Jahren arbeiten Scherzer und seine Kollegen daran, bildgebende Verfahren wie die photoakustische Tomografie (PAT) und die optische Kohärenztomographie (OCT) zu einer neuen Analysemöglichkeit für die Medizin zu verbinden. Während Letztere heute üblicherweise in der Augenmedizin angewendet wird, um Erkrankungen wie den Grünen Star oder eine diabetische Netzhauterkrankung zu diagnostizieren, ermöglicht die PAT eine dreidimensionale Darstellung von Blutgefäßen und anderen Gewebebestandteilen.
Durch Kombination mehr sehen
„Diese beiden Verfahren ergänzen sich sehr gut, da beide mit einem kurzen und intensiven Laserimpuls funktionieren“, erläutert Scherzer. Dabei zeigt das OCT an, wie das Licht im Gewebe gestreut und reflektiert wird, das PAT misst wiederum, wie viel von dem Lichtstrahl im Gewebe absorbiert wird. „Um bei dem Beispiel der Blutgefäße zu bleiben, absorbiert hier das Blut das Laserlicht. Wenn sehr viel Blut vorhanden ist, wird das PAT-Bild sehr dunkel“, erklärt der Mathematiker, der dafür verantwortlich ist die unterschiedlichen Lichtsignale der beiden Verfahren zu einem Bild zusammen zu rechnen. Diese Informationen könnte man sich letztlich für Krebsdiagnosen zunutze machen. Denn Hautkrebs kündigt sich auch dadurch an, dass mehr Blutgefäße in der Haut gebildet werden. „Jede Art von Tumor braucht nämlich mehr Blutversorgung, das könnte man auf diese Weise sehen“, erklärt Scherzer.
Bessere Anhaltspunkte für Tumorerkennung
Für das kombinierte Verfahren haben Scherzer und seine Kolleg/innen auch bereits eine konkrete Anwendung im Kopf: die Elastographie. Dabei drückt eine Platte auf die Haut und schießt den kurzen Laserimpuls in die obersten Gewebeschichten. Das zweite Mal wird der Laser ohne Druck unter die Haut befördert. Mithilfe einer Elastizitätsgleichung kann man ausrechnen, wie elastisch und steif das Material in der Haut ist und es zu einem Bild verarbeiten. „Es zeigt dabei nicht nur an, ob hier steifes Gewebe ist oder nicht. Der Vorteil ist vielmehr, dass man erkennen kann, wie steif es ist.“ Das sage zwar noch nichts darüber aus, ob das Gewebe bös- oder gutartig ist, aber es gäbe einem einen Anhaltspunkt, ob man hier weitere Untersuchungen anstellen muss oder nicht, führt Scherzer weiter aus.
Abgesehen davon könnte die kombinierte Tomographie Ärztinnen und Ärzten auch bei Tumoroperationen helfen, exakter zu arbeiten, erläutert Scherzer. „Man kann dann zum Beispiel während einer Operation Gewebeproben in Echtzeit analysieren, und weiß dadurch, ob man sich noch im veränderten Material befindet, das entfernt werden muss, oder ob man schon zum gesunden Gewebe gelangt ist.“
Wie Algorithmen und Medizin zusammenfinden
Bis dahin ist es allerdings noch ein langer Weg. Zwar werden die Rechenmodelle und die Messanordnungen immer präziser und besser aufeinander abgestimmt. Dennoch gibt es noch einige Hürden. „Man kann es mit einem alten Fernseher vergleichen. Damals passierte es manchmal, dass sich die Farben etwas verschoben haben und nicht exakt übereinander lagen. Ein ähnliches Problem haben wir, wenn es darum geht, die beiden Bilder so genau zu überlagern, dass man ein klares Bild errechnen kann.“ Um dieses Problem zu beseitigen, ist intensive Zusammenarbeit gefordert: Während die Mathematiker/innen darauf achten, dass die Rekonstruktionsalgorithmen optimal eingestellt sind, arbeiten die medizinischen Physiker/innen daran, die Messanordnung immer genauer zu arrangieren.
Eine weitere Herausforderung sind die Proben, an denen die Forscher/innen das Verfahren testen. „Wir befinden uns derzeit noch in der Entwicklungsphase. Das heißt, wir brauchen hier Material, bei dem wir die einzelnen Bestandteile genau kennen und das dem menschlichen Gewebe ähnelt.“ Bis jetzt kochen die Mathematiker/innen das spezielle Material selbst. Vergleichbar sei es mit Sülze, so Scherzer. Danach haben sie allerdings nur kurz Zeit, ihre Messungen durchzuführen, da das Material innerhalb eines Tages altert und damit unbrauchbar wird.
„Ehrlich gesagt habe ich am Anfang unterschätzt, wie schwierig das ist. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir die Technologie eines Tages so weit bringen, dass man sie bei der Haut- und Gewebeuntersuchung so einsetzen kann, wie wir uns das vorstellen.“